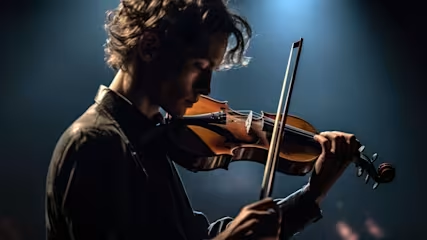André-Ernest-Modeste Grétry
Komponist: André-Ernest-Modeste Grétry
Im Schatten von Gluck, vor dem Aufstieg Mozarts und mitten im Umbruch einer revolutionären Zeit: André-Ernest-Modeste Grétry war kein Nebenakteur, sondern ein Künstler, dessen Musik das Leben seiner Zeit widerspiegelt – mit Melodien, die wie Gespräche klingen, mit Opern, die Gesellschaft spiegeln, und mit einem Schicksal, das das Pathos der Ära trägt.

Am 11. Februar 1741 wurde André-Ernest-Modeste Grétry in Lüttich geboren, in eine Familie hineingeboren, in der Musik alltägliche Gegenwart war. Sein Vater François spielte die erste Geige an einer der Stiftskirchen, die Mutter hatte Gesangsausbildung, und so wuchs André als zweites von sechs Kindern in einem von Klang erfüllten Haus auf. Schon früh sang er als Chorknabe, lernte Violine und Cembalo und erhielt Unterricht in Generalbass, Harmonik und Kontrapunkt. Doch das Leben war für ihn nie nur Musik: Eine Tuberkulose, die ihn als Kind traf, begleitete ihn sein ganzes Leben, machte ihn schwach, ließ ihn Blut spucken und erinnerte ihn stets an die Zerbrechlichkeit des Daseins.
Mit 19 Jahren brach er auf nach Rom – zu Fuß, voller Hunger nach Wissen. Dort erhielt er Unterricht unter anderem bei Giovanni Battista Casali und schrieb seine ersten Werke: kleine Quartette, Intermezzi, frühe musikalische Versuche, in denen bereits der feine Sinn für Melodie und die Nähe zum Gesang spürbar waren. Ein bedeutender Moment war seine Aufnahme in die Accademia Filarmonica in Bologna, die ihn nicht nur künstlerisch bestätigte, sondern ihn in den Kreis jener Musiker erhob, die international Anerkennung fanden.
Bald zog es ihn weiter nach Paris, den glühenden Mittelpunkt der musikalischen Welt. Hier fand er in der Comédie-Italienne eine Bühne, die seiner Kunst offen gegenüberstand. Seine Opern – meist Opéras comiques – verbanden gesprochene Dialoge mit Musik, und Grétry verstand es, Geschichten so zu vertonen, dass sie wie Gespräche klangen: natürlich, ungekünstelt, voller Empfindung. Sein Durchbruch gelang ihm mit Zémire et Azor im Jahr 1771, einer Adaption des Märchens von der Schönen und dem Tier, die das Publikum verzauberte. Weitere Werke wie Richard Cœur-de-Lion festigten seinen Ruhm und machten ihn zu einem der gefragtesten Komponisten Frankreichs.
Doch der Ruhm des Hofes hatte seinen Preis, und die politische Welt wandelte sich. Mit der Revolution verlor Grétry seine wichtigsten Auftraggeber, seine finanzielle Basis und manches Mal auch die Gewissheit, dass seine Kunst in einer Welt voller Umbrüche noch Platz hatte. Er musste Besitztümer verkaufen, sah seine Familie leiden und erlebte 1807 den Tod seiner Frau. Dennoch komponierte er weiter, schrieb Werke, die sich dem republikanischen Geist öffneten, und blieb ein Teil der kulturellen Debatte seiner Zeit.
Seine späten Jahre brachten ihm wieder Anerkennung. 1803 wurde er in die Ehrenlegion aufgenommen, ein sichtbares Zeichen, dass seine Kunst nicht vergessen war. Er lebte zuletzt zurückgezogen in Montmorency bei Paris, wo er am 24. September 1813 starb. Sein Nachruhm war beträchtlich: Noch Jahrzehnte nach seinem Tod wurden seine Werke in Paris gespielt, seine Opern gehörten zum festen Repertoire, und kaum ein Monat verging zwischen 1769 und 1824, in dem man nicht irgendwo in der Stadt eine Melodie von Grétry hören konnte.
Sein Stil verband das Italienische mit dem Französischen, die melodische Linie mit der Prägnanz des gesprochenen Wortes. Er verstand es, Empfindsamkeit, Volkstümlichkeit und Dramatik miteinander zu verweben und so ein Klangbild zu schaffen, das wie ein Spiegel der Gesellschaft wirkte. Auch wenn sein Name heute weniger bekannt ist als der Mozarts oder Beethovens, bleibt er doch der große Meister der französischen Opéra comique, ein Komponist, dessen Musik zeigt, dass Oper nicht nur große Mythen erzählen kann, sondern auch die kleinen Geschichten des Alltags – mit einem Lächeln, mit einer Träne, mit einer Melodie, die im Gedächtnis bleibt.
Genießen Sie unsere meistgehörten Musiksender
Entdecken Sie die Welt der Klassik
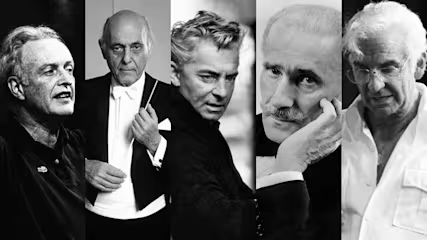
Komponisten & Künstler

Epochenwissen