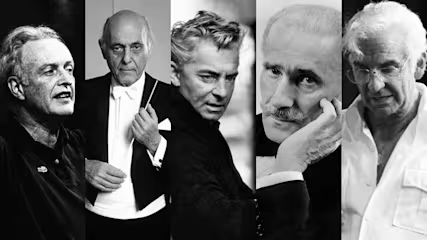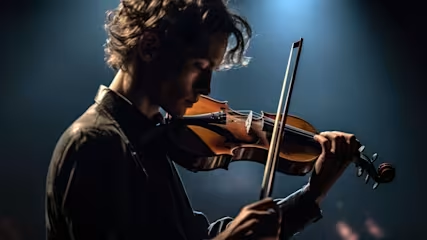Carl Orff
Komponist : Carl Orff
Es war die Vorstellung davon Musik, Bewegung und Sprache zu einer Einheit zu formen, die seine Kunst und seine Arbeit sein ganzes Leben über beeinflussen sollte.

Orffs Kindheit und Jugend
Carl Orff wurde am 10. Juli 1895 in München geboren. Bereits als Kind begleitete ihn eine Fülle von Musik, so bekam er Klavier-, Cello- und Orgelunterricht und sang gleichzeitig in verschiedenen Chören.Alleine im Jahr 1911 schreibt der Ausnahmekünstler rund 50 Lieder zu Texten von zum Beispiel Heinrich Heine. Durch seine Begeisterung für Richard Wagners Opern begann er in München Musik zu studieren. Schon damals interessierte sich Orff für Musikpädagogik, doch nach Abschluss seines Studiums wurde er zunächst Kapellmeister an den Münchner Kammersielen und wirkte kurz in Mannheim und Darmstadt.
Der Musikpädagoge
Die Studien der Musikpädagogik ließen ihn aber nie los und so kam es, dass er 1924 gemeinsam mit Gymnastik- und Tanz-Pädagogin Dorothee Günther eine Schule für Gymnastik, Tanz und Musik gründete. Bereits da versuchte er, eine Verbindung zwischen Bewegung und Musik zu schaffen. Orff erarbeitete eine umfassende Form der Vermittlung, die als sogenanntes „Schulwerk“ bis heute in Schulen im Musikunterricht verwendet wird.Nach weiteren Stationen als Dirigent und Komponist in München nahm er die Leitung des neu gegründeten „Orff-Instituts“* am Mozarteum in Salzburg an. 1955/56 wir er mit dem Ehrendoktor der Universität Tübingen, dem Orden „Pour le Métite“ und der Ehrendoktorwürde der Universität München ausgezeichnet.
Der Komponist Orff
Carl Orffs Durchbruch als Komponist gelang ihm erst 1934/37 mit der „Carmina Burana“.
André Rieu - O Fortuna (Carmina Burana - Carl Orff)
Ein großer Teil seines Schaffensprozesses war es, literarische Texte wie etwa von William Shakespeare mit modernen Gestaltungsmitteln zu verbinden und trotzdem den Eindruck historischer, religiöser und mythischer Gefühle hervorzurufen.
Eindrücke vom "Sommernachtstraum"
Ehre nach dem Tod
Am 29. März 1982 stirbt Carl Orff im Alter von 86 Jahren in München. Am 3. April wurde er, seinem Wunsch entsprechend, nur im kleinsten Familienkreis in der Klosterkirche Andechs beigesetzt, dies war für einen nicht Adeligen eine außergewöhnliche Ehre.Rückblickend war Carl Orff einer der wichtigsten tonalen Komponisten und Pädagogen des 20. Jahrhunderts, der unseren Blick auf die Musikwelt nachhaltig veränderte.* Bis heute eine international renommierte Ausbildungs- und Begegnungsstätte für Musik- und Tanzpädagogik(A. Kohler)